|
Christines Texte |
 |
Die Handschrift stirbt aus!
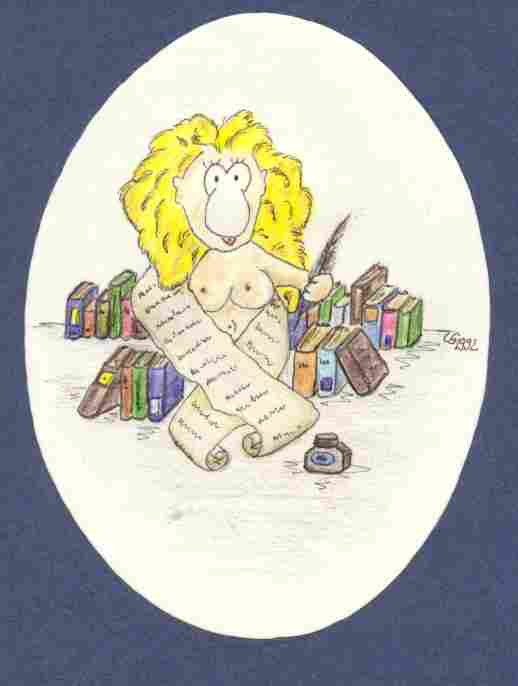 Die Autorin, gezeichnet von Claudia Sussmann HanfEine Sendung des Bayerischen Rundfunks widmete ihre Aufmerksamkeit einem brisanten Thema: die Handschrift stirbt aus!
Die Autorin, gezeichnet von Claudia Sussmann HanfEine Sendung des Bayerischen Rundfunks widmete ihre Aufmerksamkeit einem brisanten Thema: die Handschrift stirbt aus!
Was so unglaublich klingt, da wir doch alle als erstes in der Schule das Schreiben mit der Hand lernen, entpuppt sich beim genaueren Hinschauen als Tatsache. Eine, die nachdenklich macht. Ja, es stimmt, wir smsen, wir hacken auf der Computertastatur herum, wir arbeiten mit Icons und Zeichen. Handgeschriebene Briefe, Tagebücher, Reisebeschreibungen und was sonst alles gerne mit der Hand geschrieben worden ist, verliert angesichts der ungeahnten technischen Möglichkeiten an Bedeutung. Und doch: wenn ich eines meiner Tagebücher zur Hand nehme, dann sehe ich schon auf den ersten Blick, in welcher Verfassung ich zum Zeitpunkt des Schreibens gewesen bin; kleine enge und geduckte Buchstaben, wenn ich Angst oder Probleme hatte, großzügige und geschwungene in Zeiten bester Verfassung. Von den Feinheiten dazwischen wollen wir gar nicht reden.
Das kennen Sie sicher auch: ich lerne jemanden kennen. Eine Art Grundeinschätzung der Person stellt sich schnell ein. Und dann sehe ich ihn plötzlich schreiben. Die Neugier plagt mich sehr: wie sieht seine Handschrift aus? Ob ich will oder nicht, sie teilt mir etwas mit. Oberlängen, Unterlängen, Neigung, gebundene Buchstaben... auch ohne dass wir Graphologie zum Hobby machen, interpretieren wir die Handschrift. Sie ist etwas ganz und gar persönliches, sie können wir unter anderen erkennen, wie auch den Gang eines Menschen oder seine Stimme. Die Bibliotheken und Archive sind voll von handschriftlichen Sammlungen, die noch heute so vieles über die Schreiber erzählen, und seien sie auch schon Hunderte von Jahren nicht mehr unter uns.
Und darauf wollen wir verzichten? Zugunsten elektronischer Datenträger?
Gerade heute sind wir doch alle so versessen auf jede Form von Individualität. Dann würde es Sinn machen zu überlegen, worin sie tatsächlich besteht.
Ich fange heute wieder damit an. Heute abend lege ich meinem Max mal wieder einen Liebesbrief unters Kissen.....
Auf der falschen Seite des Mondes
Teberinte
Seit kurzem wächst in meinem Garten ein Baum, den es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Aufgeworfene Erde zeugte tagelang von Umtrieben im dunklen Unten. Und auf einmal stand er da. Noch nicht sehr groß, und trotz seiner Jugend umkleidet seinen Stamm eine schwielige, furchige Rinde in hellem und dunklen Braun, auch Schimmer von weiß auf den obersten Borkenrücken. Blätter in allen Facetten des Grün, spitz in den Stängel auslaufend, unten dick und runder, wie Tränen, kleiden sein verzweigungsfreudiges Geäst.
Staunend ging ich auf ihn zu und erfuhr aus einem scharfen Windstoß an meinem Ohr seinen Namen. Teberinte.
Er gedeiht nur nachts, unter Mond und Sternen. Das silbrige Licht ist ihm Dünger und Sehnsucht. Das Laub spiegelt die Himmelslichter, wirft sie hin und her, hinauf und hinunter und erzeugt damit Silberexplosionen wie ein Bündel Wunderkerzen es nicht besser könnte. Die Silberfäden verwebt er unsichtbar.
Doch am Tage, wenn die Sonne hoch am Himmel steht, ruht er, völlig ohne Regung. Nur dann und wann fällt ein Blatt vom Baum. Darauf haben sich die Silberfäden in Schlingen gelegt und erzählen Geschichten. Manchmal sind es nur wenige Zeilen, manchmal Geschichten wie dicke Bücher. Ganz vorsichtig berge ich das Laub und lege es in eine dunkel ausgekleidete Schachtel. Ein paar Sternchen lege ich dazu.
BILD Dir Deine Meinung –
moralische Betrachtung zur Verb‐Bildung in der deutschen Sprache
Silvester 1946. Deutschland lag geschlagen und erstarrt in Kälte, in Hunger, in Armut.Der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings hielt in St. Engelbert in Köln‐Riehl seineJahresendpredigt. Er predigte unter anderem über die zehn Gebote. Zum 7. Gebot (Du sollst nicht stehlen) sagte er zum Entsetzen der britischen Besatzungsmacht: „Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder Bitten, nicht erlangen kann“. Die Folgen: Menschen, die etwa Briketts von Eisenbahnzügen oder Lebensmittel stahlen, um nicht zu erfrieren und zu verhungern, sahen sich nun moralisch bestärkt. Die Worte des Erzbischofs schienen ihnen eine Rechtfertigung für die Entwendung von fremden Eigentums. Schnell kam für „Kohlenklau“ das Wort „fringsen“ auf, und fand später sogar Eingang in ein „Lexikon der Umgangssprache“. Wer kennt es noch? Fringsen war Selbsthilfe, wenn nichts mehr half –auch Gebete nicht‐ . Dicke fette Sahne für himmlischen Kaffeegenuss haltbar zu machen, entwickelte Louis Pasteur. Zur Belohnung verbalisierte unser Sprachgebrauch seinen Namen. Auch Herrn Weck widerfuhr diese Ehre, würdigend seine Methode zum Einmachen von Obst und Gemüse. Wilhelm Konrad Röntgen bemühte sich zwar nicht um die Entwicklung rund um kulinarische Genüsse, aber seine Erfindung der Durchleuchtung menschlicher Körper wirkt sich noch segensreicher aus, weshalb sein Name ein ganzes Spektrum spezifischer Fachausdrücke anführt. Die meisten Menschen sind sich der Namensgeber gar nicht mehr bewusst, der Bezug zu dem zugrunde liegenden Eigennamen sind ganz oder teilweise vergessen. Ich selbst glaubte lange, eine Litfaßsäule hieße so, weil an einem Fass Lithografien aufgehängt werden und staunte nicht schlecht, als ich von Herrn Ernst Theodor Amandus Litfaß erfuhr, der just dies Fass zum Anbringen von Nachrichten erfunden hatte.
Nun handelt es sich bei den beschriebenen Beispielen zweifelsohne um der Menschheit zuträgliche Entwicklungen, die ihren Schöpfern mit Recht einen dauerhaften Platz in unsere Sprache sichern.
Seit einiger Zeit gefallen sich die Medien als Wortschöpfer, indem sie Schlagzeilen in gebrauchsfähige Wörter verwandeln. Die Werbung hatte damit ganz harmlos begonnen, man denke nur an pfandige Cola, unkaputtbare Flaschen, an Maroditis – wogegen Milch helfen soll – und die Duplomatie. Auch die Verben hartzen und riestern haben sich im Sprachgebrauch seit einiger Zeit etabliert, obwohl ihre »Paten« Peter Hartz und Walter Riester längst anderweitig aktiv sind. Die damit beschriebenen Vorgänge sind bei weitem nicht so honorabel wie die der Röntgen‐Gruppe und weit weniger schmackhaft als Eingewecktes, aber immerhin erhalten sie sich noch eine gewisse Neutralität. Unsere allüberall herrschende Freude an der Sensation, an Schmutzflecken auf scheinbar weißen Westen öffnet den anrüchigen, somit anti‐moralischen Wortgeschwistern Tür und Tor in unsere Wörterwelt. Die Ignoranz gegenüber gängiger Gesetzgebung und moralischen Grundwerten hochrangiger, in Vorbildfunktion agierender Persönlichkeiten bescheren uns Wörter, auf die unsere Gesellschaft getrost verzichten könnte. Guttenborgen mag als Metapher für plagiieren, für das Stehlen geistigen Gedankenguts, noch einigermaßen originell sein. Dass, und hier guttenborge ich aus einem wirklich gut geschriebenen Leitartikel, Karl‐ Theodor zu Guttenberg infolge der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit sämtliche politischen Ämter bereits im März letzten Jahres niedergelegt hat, scheint der Popularität des abgeleiteten Verbs kaum Abbruch zu tun. Das ist umso auffälliger, als der Name Guttenberg und das Verb guttenborgen sprachlich ja relativ sperrig sind. Dies gilt natürlich noch mehr für Formen des Verbs, wie sie in einem Satz auftreten können, etwa geguttenborgt, aber auch diese Formen kann man durchaus im Sprachgebrauch finden.
Aktuell drängt das Verb wulffen über intensives Infotainment in die Alltagssprache. Als zwiefaches kommt es daher: als Floskel für verbales Vollmüllen von Anrufbeantwortern sowie als Emulsion aus Wahrheit und Lüge, ein sprachliches Wackelbild. Je nach Blickwinkel und politisch‐empathischer Einstellung fokussiert unsere Wahrnehmung nun eine Wahrheit oder ein Lüge. Aber der Witz dabei ist, dass beide untrennbare Bestandteile der gleichen Argumentation sind. Leidet Herr Wulff in Ausübung seines bundespräsidialen Dienstes zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit bittere Entbehrung, welche er weder durch Arbeit noch durch Beten ausgleichen kann, und sah sich deshalb zum Fringsen genötigt? ‐ 3 ‐
Ohne im ersteren Wortsinn wulffen zu wollen – ich sehne Zustände wie in Italien und Frankreich herbei, wo eine beinah 500jährige Accademia della Crusca oder die nur wenig jüngere Académie Francaise über die Reinheit der Sprache wachen. Ob uns das zupass käme?
Zur Klärung der Frage empfehle ich googeln.
Luigi Grilli ist gestorben
Luigi Grilli ist gestorben. 83jährig in seiner Heimatstadt St. Combano in Italien.
Anna war zwölf, höchstens dreizehn Jahre alt, als sie Luigi Grilli das erste Mal sah. Damals interessierte sie weder der Mann, der Italiener, noch das Lokal, das seinen Namen trug. Sie war dahin geschleppt worden von Günter und von ihrer Mutter. Die hatten sich da zu einem Krisengespräch getroffen. Warum Anna unbedingt dabei sein sollte, begriff sie erst später. Aber als dieser Teigfladen vor ihr auf dem Tisch lag, verstand sie , dass sie missbraucht werden sollte.
Pizza nannte Günter das Ding. Schon vor dem Lokal hatte er die italienische Küche über den grünen Klee gelobt und beteuert, dass er wahnsinnig glücklich sei, endlich auch daheim den südländischen Genüssen nah zu sein. Anna erinnerte sich an den Spott des Vaters, wenn wieder einmal eine Postkarte von Günter aus Cesenatico eingetroffen war. Auf der Vorderseite ein Strand voller Strandkörbe und Hunderten von Menschen unter Sonnenschirmen an ein wenig Adria, hinten drauf lapidare Grüße. Als Lehrer konnte Günter häufiger als andere in die Ferien fahren und die verbrachte er ausschließlich in Cesenatico.
Auf der Pizza lagen allerlei andere Sachen herum. Obendrüber spannte sich ein Netz aus geschmolzenem Käse. Wie ein Gummi hielt der Gemüse und Salamie zusammen.
Ohne Unterlass redete die Mutter auf Günter ein. Von ihrer Pizza aß sie nur dann und wann ein Stück. Anna konnte nicht erkennen, ob sie das mit Genuss tat. Denn sobald sie den Mund wieder frei hatte, zählte sie neue Schandtaten ihres Ehemanns auf. Also von Annas Vater.
Günter wiederum aß hingebungsvoll und brummte nur zu den Ausführungen der Mutter. Beide tranken Rotwein, die Mutter schon das zweite Glas.
An der Stirnseite des Tisches, mit dem Rücken zum Fenster aus braunem Rauchglas, saß Anna. Rechts die Mutter, links Günter. Mit der Gabel pickte sie Gemüsestücke von der Pizza und zog sie so lange in die Höhe, bis der Käsefaden endlich riss.
Seit zwei Wochen schon wohnte Annas Vater nicht mehr daheim. Er hatte sich ein möbliertes Zimmer nahe seinem Arbeitsplatz gesucht. Rausgeworfen hatte die Mutter ihn. Laut und kreischend hatte sie das getan. Betrunken. Der Vater duckte sich unter ihrem Geschrei weg und suchte seine Sachen zusammen. Auch Dokumente und Schmuck.
Und die wollte die Mutter nun wieder haben.
Und dafür brauchte sie Günter. Der war ein alter Freund des Vaters aus Studientagen. Eine ruhige Art habe er, meinte Mutter, ein nervtötender Erbsenzähler meinte Anna. Jedenfalls sollte er im Guten versuchen, den Vater zur Herausgabe der begehrten Dinge zu bewegen.
Falls der aber keinen Erfolg hätte, musste Plan zwei durchgeführt werden.
Und dafür brauchte sie Anna.
Anna, die ihren Vater anbetete. Die ihm alles erzählte, die ihn schrecklich vermisste. Die sollte den Vater beschäftigen. Und während dessen würden die beiden anderen….
Nein, Pizza war nicht Annas Ding.
Möge er in Frieden ruhen, der Luigi!
(Oktober 2013)
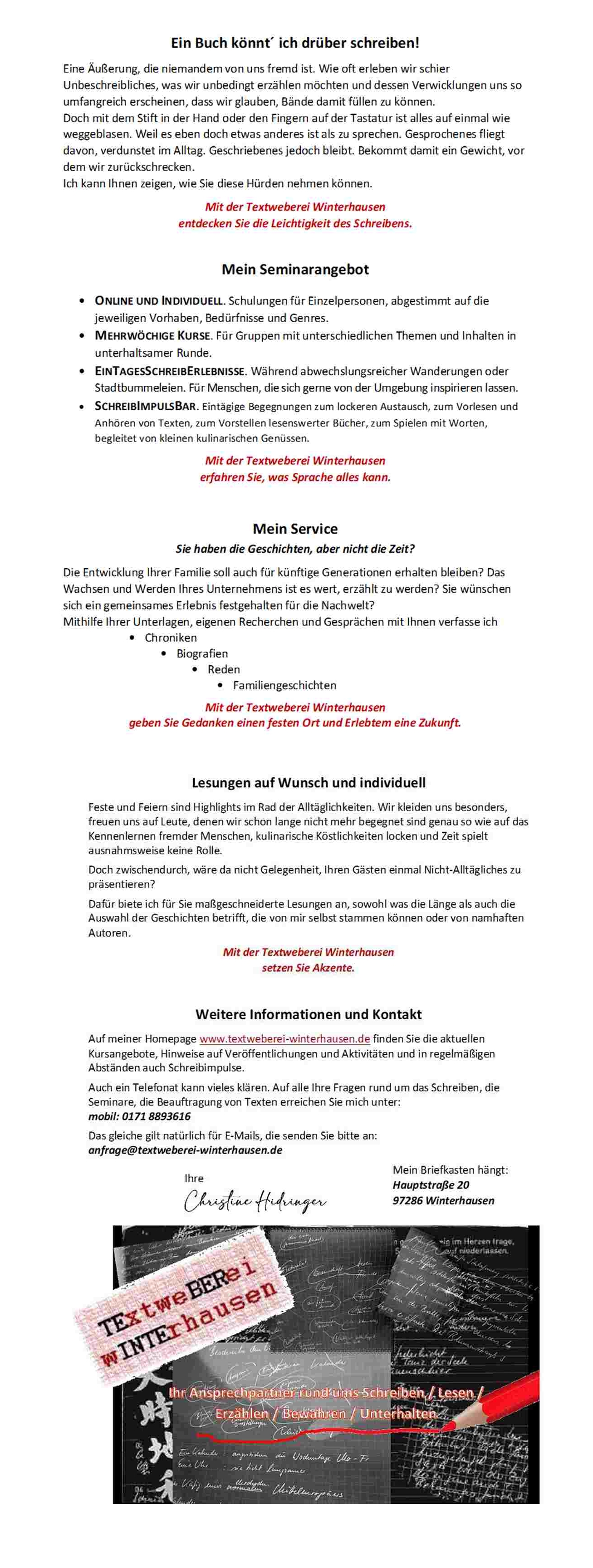 Faltblatt
Faltblatt

